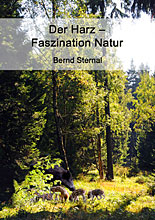|
 Der Gemeine Hallimasch Der Gemeine Hallimasch
|
Der Gemeine Hallimasch ist im Herbst einer der am
häufigsten vorkommende Pilz in den Harzer Wäldern. Sein
Vorkommen ist fast unbegrenzt, er wächst in Laub- und
Nadelwäldern, liebt aber besonders totes Holz.
Dieser Pilz aus der Ordnung der Blätterpilze stellt ein
kleines Phänomen im Bereich der Flora dar, er ist
weltweit verbreitet. Der Pilz mit dem Botanischen Namen
Armillaria mellea hat seinen ungewöhnlichen Namen aus
der Heilkunde. Früher wurde der Pilz als Heilmittel
gegen Hämorrhioden eingesetzt und erhielt von der
Verkürzung von „Heil am Arsch“ seinen Namen.



In manchen Jahren kommt der Hallimasch massenhaft vor.
Dann stellt er eine nicht zu unterschätzende Gefahr für
den Wald dar. Er ist ein gefährlicher Baumschädling,
dessen schwarze Hyphenstränge sich schnürsenkelförmig
ausbreiten und unter der Borke der Bäume ein
weitflächiges Myzel bilden. Parasitär entzieht er den
Bäumen die Nahrungsgrundlage bis zu deren Tod.
Durch Biolumineszens bringt der Hallimasch in bestimmten
Wachstumsphasen das Holz, auf dem er gedeiht, zum
Leuchten. Neben dem Wurzelschwamm zählt der Hallimasch
zu den für den Wald wirtschaftlich bedeutendsten
Schädlingen aus dem Bereich der Pilze, in unserer
gemäßigten Zone.
 

Dem Gemeinen Hallimasch sind aber auch positive Seiten
abzugewinnen. Er ist ein beliebter und schmackhafter
Speisepilz. Allerdings nicht für jeden, denn er ist
schwer verdaulich. Und im rohen Zustand ist er leicht
giftig! Er sollte daher vor dem Verzehr mindestens 10
Minuten gekocht oder gebraten werden.
Der Hallimasch besonders zum sauer Einlegen geeignet,
schmeckt aber gebraten oder in der Soße gut. Seine
Konsistenz ist nicht jedermanns Sache, da er auch durch
den Garvorgang kaum an Festigkeit verliert.
Seine chemische Struktur konnte bisher noch nicht
zweifelsfrei geklärt werden. Dagegen ist uns sein
Äußeres wohl bekannt. Der Pilzführer beschreibt in wie
folgt: Der Hut wird etwa zehn Zentimeter breit,
bräunlich bis honiggelb, mit dunklen, büscheligen und
haarigen Schüppchen. Seine Lamellen sind weiß bis
rötlichgelb. Der bis zu fünfzehn Zentimeter lange,
gelblichbraune Stiel ist wegen büscheligem Auftreten oft
verbogen.


zurück
Copyright der Fotos und des Textes Bernd Sternal 2008
|
 Der
Harz - Faszination Natur Der
Harz - Faszination Natur
von Bernd Sternal |
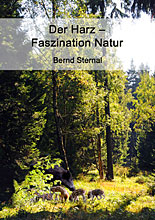
|
Wir treten
für den Schutz von Eisbären, Tigern, Löwen
und anderen Raubtieren ein, den Wolf in
Deutschland lehnen wir jedoch zum Großteil
ab und auch der teilweise wieder
angesiedelte Luchs ist vielen suspekt. Wir
schützen Tiere und Pflanzen, wobei der
Schwerpunkt auf niedlichen und
ungefährlichen Tieren liegt, bei Pflanzen
müssen diese möglichst ansehnlich sein,
hübsch blühen oder wohlschmecken.
Borkenkäfer, Fliegen, Wespen, Weg- und
Gartenameisen, Motten, Asseln und vieles
mehr haben hingegen keine Lobby, dennoch
sind sie alle Bestandteile unserer Natur.
Wir unterscheiden in Neobiota und
einheimischer Flora und Fauna. Unter
ersterem versteht man Arten von Tieren und
Pflanzen, die erst nach dem 15. Jahrhundert
hier eingeführt oder eingewandert sind. Dazu
zählen beispielsweise bei den Tieren:
Waschbären, Marderhunde, Nerze, Nutrias,
Mufflon oder Streifenhörnchen. Bei den
Pflanzen ist der Riesenbärenklau derzeit in
aller Munde, es gibt jedoch weitere
unzählige Arten. In Deutschland kommen
mindestens 1.100 gebietsfremde Tierarten
vor. Davon gelten allerdings nur etwa 260
Arten als etabliert, darunter 30
Wirbeltierarten.
Übrigens: Auch die Kartoffel, die Tomate,
der Paprika und die Gurke sind Neophyten,
also nicht heimische Arten.
Wir beginnen dann Arten in nützliche und
schädliche zu unterscheiden. Dabei nehmen
wir wenig Rücksicht auf die Rolle der
jeweiligen Art in den Ökosystemen, oftmals
kennen wir diese auch gar nicht. Wir führen
Tiere und Pflanzen aus der ganzen Welt ein
und sind dann verwundert, wenn die eine oder
andere Art außer Kontrolle des Menschen
gerät und sich unkontrolliert vermehrt. Den
Rest, in Bezug auf neobiotische Pflanzen,
Tiere und Pilze, erledigt die
Globalisierung.
Auch unsere Landschaft verändern wir
fortwährend. Was durch geologische Prozesse
in vielen Millionen Jahren entstanden ist,
weckt seit einigen Jahrhunderten das
zunehmende Interesse des Menschen. Wir
betreiben Bergbau - unterirdisch und in
Tagebauten -, wir fördern Erdöl und Erdgas
aus den Tiefen unseres Planeten, wir bauen
Sand, Kies, Kalk, allerlei Gestein und
vieles mehr ab.
Zwar versuchen wir mittlerweile den Abbau
fossiler Brennstoffe zu begrenzen und einen
Ausstieg vorzubereiten, jedoch ist die
Bauindustrie unersättlich. Unsere Städte,
Dörfer, Verkehrswege und Firmenanlagen
fordern ihren Tribut. Jedoch muss der
Großteil der Welt erst noch Straßen und
feste Gebäude erbauen. Wollen wir das diesen
Menschen versagen?
Im Buch finden Sie 71 farbige und 27
schwarz-weiße Fotos sowie mit 16 farbige und
37 schwarz-weiße Abbildungen zu den
einzelnen Themen. |
|
oder bestellen bei Amazon |
|
 |
|
|
|
|